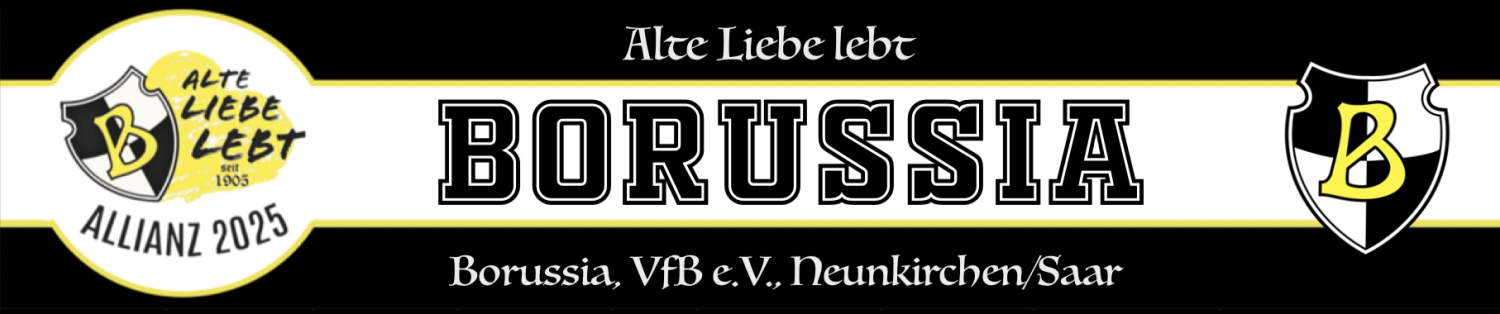Woher kommt eigentlich der Begriff „Schlachtenbummler“?
Unser Bild: Sorgen für Stimmung auf den Plätzen in der Saarlandliga – Borussias „Schlachtenbummler“ mit ihrer Konfetti-Choreo anlässlich des ersten Saisonspiels im August 2024 in Jägersburg. (Archivfoto; -jf-)
Trink- und sangesfreudige Engländer, Schotten mit Kilt und Dudelsack, Niederländer alle in oranje – wenn diese Menschen das Bild der Städte prägen, ist jedem klar: Ein großes Fußballevent ist angesagt! Doch auch ein paar Klassen tiefer in der Saarlandliga kann man das Phänomen beobachten: Schwarz-weiße Quierschieder, die ihr Banner mit der Aufschrift „Wambe-Ultras“ ausrollen, grün-weiße Schwalbacher, die stolz ihre Fahne schwenken, schwarz-rote Köllerbacher, „die imma do sinn“, schwarz-weiße Borussen, die mit einer Choreo, seien es Bänder in den Vereinsfarben oder ein gelb-schwarzer Konfetti-Regen, aufwarten. Sie alle eint ein Begriff, den es so wohl nur in der deutschen Sprache gibt: Schlachtenbummler. Im Mutterland des Fußballs spricht man von „away supporters“, in Holland von „de meegereisd supporters“ oder „uitwedstrijdfan“, der Italiener hat eigentlich kein entsprechendes Wort und benötigt eine Umschreibung, wenn er vom „tifoso che segue la propria squadra nelle trasferte“ spricht.
Schlachtenbummler. Die Bezeichnung ist allerdings, hört man genauer hin, in der letzten Zeit aus der Sprache der Medien weitgehend verschwunden. Stattdessen ist von „mitgereisten Anhängern“ die Rede. Ob das was mit dem wirklich bitterernsten Ursprung des Begriffs Schlachtenbummler zu tun hat? „Der Ausdruck bürgerte sich Ende des 18. Jahrhunderts ein und war nach den deutschen Einheitskriegen, insbesondere dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 ein gängiger Begriff, der auch ins Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm aufgenommen wurde“, erfährt man in der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“. Ein Schlachtenbummler war demzufolge ein Zivilist, der aus Neugier Manöver, Aufmärsche, ja sogar die Kriegsfront, wo die Schlachten tobten, besuchte. Die interessierte Zuwendung und Betätigung als Schlachtenbummler war laut dem Historiker Ralf Pröve „im 18. Jahrhundert weit verbreitet“. Später wurde der Ausdruck dann auf Anhänger von Sport-, vor allem Fußballvereinen übertragen, die ihrer Mannschaft zu Auswärtsspielen folgen. „Die kriegerische Wurzel des Begriffs lebt im heutigen Begriff fort: Fußballfans reisen ihrer ´Truppe´ an die Orte ihrer ´Kämpfe´ hinterher und vollziehen so eine meist friedliche Ersatzhandlung als Kriegssimulation. Doch auch die mitunter gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen `verfeindeten´ Fanlagern (wie bei der Euro 2024) verweisen auf den schon im Wort erkennbaren ersatzkriegerischen Hintergrund und die Konkurrenzorientierung einer heutigen Schlachtenbummler-Existenz“, erläutert Dr. Tobias Arend, Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.


Schwalbacher und Quierschieder Fans im Ellenfeld (oben), Köllerbachs „die, die imma do sinn“ in der Ferraro-Sportarena und Borussen in Hasborn (unten): Beispiele für begeisterungsfähige, aber friedliche Schlachtenbummler in der Saarladliga. (Fotos: -jf-)


Arend verweist dabei allerdings auf die zunächst „unscharfe Bedeutung des Begriffs“ im historischen Kontext hin. Menschen, die sich im Umfeld kriegerischer Ereignisse aufhielten und dem Geschehen entweder direkt bewohnten oder nachreisten, hätten ganz unterschiedliche Motive für dieses Verhalten gehabt. Angehörige von Wehrpflichtigen (Arend spricht von „Sorgenträgern“) gehörten ebenso dazu wie Berichterstatter oder Menschen, die zivile Dienstleistungen (z. B. Erste Hilfe und Pflege von Verwundeten im Lazarett) an der Front vollbrachten oder einfach Geschäfte (Photographien, Genusswaren, Prostitution) machten. Aber auch die Sensationslust habe den einen oder anderen an den Ort der Schlachten getrieben. Die Entwicklung sei begünstigt worden durch die Eisenbahn, die es deutlich einfacher gemacht habe, dem Kriegsgeschehen auch über größere Entfernungen nachzureisen. Arend nennt aus seiner historischen Forschung als Beispiel Johann Zeitz, Geschäftsmann und Vater zweier Söhne, die beide 1870/71 im Feld standen. Ihn habe die Sorge um die Kinder sogar angetrieben, das Schlachtfeld von Wörth (Schacht vom 6. August 18710) abzusuchen: „Ich bat Gott, mich nichts finden zu lassen.“ Der Theaterkritiker Theodor Fontane, der später zum berühmten Romancier wurde, reiste 1870 auf das Schlachtfeld, um sich Notizen für sein geplantes Buch über den Krieg zu machen, und wäre dabei fast erschossen worden. Der Dichter der Deutschen, Johann Wolfgang Goethe, begleitete 1792 den Feldzug der ersten Koalition gegen das revolutionäre Frankreich und hielt seine Erinnerungen in der Schrift „Kampagne gegen Frankreich“ fest.
Entscheidend beigetragen zur Entwicklung hat laut Arend auch der im 19. Jahrhundert aufgekommene Nationalismus: „Emotionen der Identifikation mit der `nationalen´ Sache, wie sie frühere Zeiten vor der französischen Revolution nicht kannten, brachen sich nun im Phänomen des patriotischen Schlachtenbummlers Bahn.“ Arend glaubt, dass diese Zusammenhänge auch heute Wochenende für Wochenende durchaus noch ihr Echo in den Schlachtenbummlern und Ultras hätten, die sich per Zug der Bus mühsam durch Deutschland „kämpfen“, um für ihre „nationalen“ Farben und Symbole einzustehen.
Und der zweite Bestandteil der Bezeichnung Schlachtenbummler? Das Anhängsel „-bummler“ ist laut Duden eine Wortbildung aus dem Niederdeutschen und leitet sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts vom „Hin- und Herschwanken“ der beim Läuten hin- und her schwingenden Glocke („bum-bum“) her. Daraus habe sich etwa 100 Jahre später die Bedeutung des „langsamen Schlenderns“ entwickelt.
In der saarländischen Fußallszene hat der Begriff des Schlachtenbummlers viel von seiner ursprünglich martialischen Bedeutung verloren. Auch wenn sie ab und zu noch – im wahrsten Sinne des Wortes – „aufflammen“, die alten Rivalitäten gerade zwischen den großen Traditionsvereinen: Zwischen Neunkirchen und Homburg, zwischen Homburg und Saarbrücken, zwischen Saarbrücken und Homburg. Inzwischen als Konkurrentin hinzugekommen: Die SV Elversberg. Aufgebrochen wurde zuletzt (nicht zulezt dank persönlicher Beziehungen) die in den 60er- und 70er-Jahren besonders starke Gegnerschaft zwischen der Borussia und dem 1. FC Saarbrücken: Eine Fahne mit den Logos beider Clubs wird mittlerweile sowohl im Ludwigspark als auch im Ellenfeld geschwenkt – für viele alte Borussen weder nachvollziehbar noch vorstellbar. Und doch: Sollten in einer zunehmend kommerzialisierten und globalisierten Fußballwelt, in der für normale Menschen nicht mehr nachvollziehbare, ja geradezu unerträgliche Summen im Spiel sind und sich das sportliche Geschehen zunehmend auf die großen Clubs konzentriert, nicht eher die beiden Losungen ineinandergreifen: „Support your local team“ und „In Farben getrennt, in der Sache vereint“? Eine solche begeisterte Unterstützung des eigenen Clubs, verbunden mit dem gebührenden Respekt vor dem Gegner, ist ganz sicher im Sinne des heimischen Fußballs! (-jf-)